Leyya – Sauna
Leyya – der Name des experimentellen Electro-Duos von Marco Kleebauer und Sophie Lindinger aus Österreich heißt auf Inuktitut so etwas wie Vermarktungsstrategie. Bei den trommellastigen Beats und im Ohr bleibenden Melodien auf dem neuen Album Sauna ist ein exzessives Marketing aber gar nicht nötig. Interessante Pop-Musik setzt sich immer durch. Und der Mix aus dem klackernden Rhythmen, ungewöhnlichen Instrumenten und groovigen Bassläufen überzeugt.
Der erste Track „Sauna“ des Albums ist weniger als zwei Minuten kurz. Er beginnt mit der Radioansage einer Frau namens Jane, die Leyya ankündigt. Sie erklärt, dass die Band über Instrumente aus der ganzen Welt verfügt – wie zum Beispiel eine indische Sitar. Mit einem Trommelwirbel, der die rauschenden Radiowellen verschwinden lässt, beginnt ein mächtiger Groove, in dem Sophie Lindinger „all this sweat is gonna make me wet“ wiederholt. Der kurze Ausschnitt ist ein Intro für den nächsten Song „Drumsolo“. Dieser ist ein poppiger Hit, der nach der ersten Strophe mit der Ankündigung „Solo!“ durch eine knallende Snareeinlage unterbrochen wird. Den sonst fließenden Melodien in Gestalt des für Lindinger typisch gehauchten Gesangs, des Synthesizers und wabernder Bässe tut diese abrupte Pause gut – sie bringt zusätzliche Spannung in die Komposition.
Die veröffentlichte Single „Heat“ definiert sich ebenfalls über die Rhythmusinstrumente. Und auch wenn der Snareschlag hier immer gleich bleibt, wirkt er in Kombination mit den klackernden Sounds von lateinamerikanischen Holzblocktrommeln im Hintergrund und der in geraden Vierteln gespielten Hi-Hat treibend. Durch den melodiösen Gesang und der unaufdringlichen Synthie-Untermalung kommt ein Ohrwurm zustande, den man sich gut als Sommer-Hit vorstellen kann. Das Video dazu untermalt mit viel fluoreszierendem Licht in einer dunklen Industriehalle und einem amerikanischen Radio-Intro die Vielschichtigkeit der Band. Denn nicht nur Instrumente aus aller Welt gehören zu Leyya. Sie fühlen sich auch sichtlich wohl in einer Szenerie, die nicht viel mit ihrer Heimat gemein hat.
Leyya – Sauna auf Amazon anhören
David Byrne – American Utopia
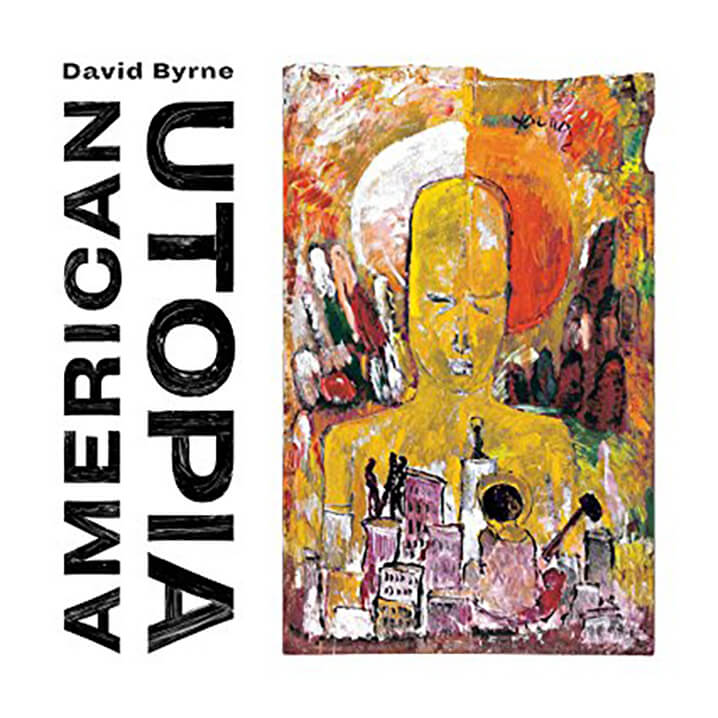 David Byrne ist ein richtiger Tausendsassa der Künste. Seitdem er als Frontmann der Talking Heads in den 80ern Erfolg hatte, komponierte er Bühnenmusik, eine Oper, veröffentlichte Bücher, ist Fotograf, Schauspieler oder war Regisseur und Produzent eines Films. Nebenbei brachte er dreizehn Alben heraus, von dem American Utopia sein neustes ist. Über Dekaden hat Byrne mit vielen verschiedenen musikalischen Einflüssen experimentiert – so arbeitete er bereits 1981 zusammen mit Brian Eno am analogen Sampling und beschäftigte sich ausführlich mit traditioneller Musik aus aller Welt.
David Byrne ist ein richtiger Tausendsassa der Künste. Seitdem er als Frontmann der Talking Heads in den 80ern Erfolg hatte, komponierte er Bühnenmusik, eine Oper, veröffentlichte Bücher, ist Fotograf, Schauspieler oder war Regisseur und Produzent eines Films. Nebenbei brachte er dreizehn Alben heraus, von dem American Utopia sein neustes ist. Über Dekaden hat Byrne mit vielen verschiedenen musikalischen Einflüssen experimentiert – so arbeitete er bereits 1981 zusammen mit Brian Eno am analogen Sampling und beschäftigte sich ausführlich mit traditioneller Musik aus aller Welt.
Vielleicht klingt auch deshalb die Musik auf „American Utopia“ so interessant. Ungewöhnliche Sounds werden so selbstverständlich in die Lieder eingebaut, als ob der Ideenreichtum Byrnes keine Grenzen kennen würde. Sei es ein leicht bluesiges, gepfiffenes Solo auf „It’s not Dark up here“ oder der orchestrale Einstieg von „Dog’s Mind“, der eher so klingt, als stimmten die Musiker gerade ihre Instrumente: jeder der zehn Songs ist so überraschend wie eine Forrest Gump Praline. Mal denkt man an Filmmusik, mal auch an die Talking Heads, wie bei dem brachialen, New-Wavigen Chorus des ersten Tracks „I Dance like this“.
Erst seit 2016 besitzt Byrne die US-Staatsbürgerschaft, obwohl er schon in seiner Kindheit aus Schottland in die USA zog. In „Dog’s Mind“ kritisiert Byrne mit harschen Worten die Präsidentschaft Trumps, welcher der erste Präsident ist, den er hätte wählen können. „The judge was all hungover when the president took the stand – so he didn’t really notice when things got out of hand“ singt er einleitend. Wie sehr in den USA alles im Chaos verlaufe, beschreibt er weiter anhand der turbulenten Pressekonferenzen von Trump, in denen der Präsident den „Press Boys“ sagen würde, was sie schreiben sollten. Byrnes dürfte die in Mitleidenschaft gezogene amerikanische Presse besonders berühren. Er selbst veröffentlichte Kommentare und Artikel in der New York Times. Seine im Text scharf formulierte Kritik jedenfalls ist musikalisch so schmeichelhaft verpackt und später aus einer sorgenlosen Hundesicht erzählt, dass man ihm für diese Ambivalenz, die gleichzeitig den zerrissenen Zustand seines Landes darstellt, applaudieren möchte. Zwar wird Trump sich selbst nicht angesprochen fühlen, doch vielen Zuhörern wird Byrne aus der Seele sprechen.
David Byrne – American Utopia auf Amazon anhören
Editors – Violence
Die tragende Melodie in Tom Smiths Gesang wirkt schon nach wenigen Sekunden vereinnahmend. Das neue Album Violence der britischen Indie-Gruppe Editors beginnt ganz ruhig. Die musikalische Untermalung aus Schlagzeug, Bass und Synthesizer hält sich bis zur Hälfte des ersten Tracks „Cold“ im Hintergrund. Dann durchbricht die E-Gitarre die Ruhe, es wird rockiger. Trotzdem steht Smiths charakteristischer Bariton, der teilweise an Leonard Cohen erinnert, stets im Vordergrund. Im nächsten Song „Hallelujah ( So Low)“ ändert sich das: Ein schnittiges Riff aus Synthesizer, Bass und Gitarre unterbricht die Gesangslinien immer wieder und ist so eingängig, das es als Chorus gelten könnte.
„Violence“ ist das inzwischen sechste Album der Editors. Auf ihm präsentieren die Musiker eine abwechslungsreiche Mischung aus Stilen. Darunter finden sich Electro-Hymnen wie der Titelsong „Violence“ oder gesangsfokussierte Lieder wie der beschriebene Song „Cold“. Seit ihrer ersten Veröffentlichung 2005 experimentierte die Band über die Jahre immer mehr mit neuen elektronischen Einflüssen. Die neue Ausrichtung führte zu Unstimmigkeiten in der Gruppe – Gitarrist Chris Urbanowicz stieg 2012 schweren Herzens aus, weil er sich die zukünftigen Alben anders vorstellte. Urbanowicz lebt heute in New York und betrachtet das Musikmachen als Produzent nun aus einer anderen Perspektive.
Seitdem hat die Band mit neuer Besetzung nun insgesamt drei Albem auf den Markt gebracht. Mit Violence scheint es, als ob die Editors eine neue musikalische Balance gefunden haben. Die Musik ist nicht mehr überwiegend elektronisch und die typischen Bandinstrumente Gitarre, Bass und Schlagzeug laufen nie Gefahr zu kurz zu kommen. Obwohl Synthesizer in jedem Song auftauchen, geraten sie nicht dominant, sondern reichern die Arrangements mit interessanten Elementen wie einem geheimnisvollen Rauschen im Titelsong an. Besonders schön ist „No Sound but the Wind“ – der Song erinnert mit seinem Fokus auf Smiths Stimme und einem feinfühligem Klavier im Hintergrund an die Anfangszeiten der Editors. Was damals schon klar war und hier wieder durchkommt: die Stärke der Band bleibt immer noch der großartige Gesang des Frontmanns.
Editors – Violence auf Amazon anhören






